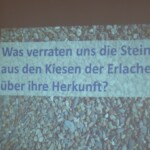2015
Beim ersten Treffen in diesem Jahr haben wir Nistkästen gebaut. Noch ist Winter, aber bald fangen viele Vögel an, sich einen geeigneten Platz für die Aufzucht ihrer Jungen zu suchen. Da immer mehr alte Bäume mit natürlichen Höhlen aus den Wäldern verschwinden, und auch unsere hübsch angelegten Gärten kaum mehr über natürliche Nistmöglichkeiten verfügen, helfen wir mit unseren Nistkästen den bei uns vorkommenden kleinen Höhlenbrütern.
Kohlmeisen, Blaumeisen, Kleiber sind die häufigsten Vogelarten, die in unsere Kästen gehen.
Bevor wir uns in der Werkstatt an die Arbeit gemacht haben, hat uns Heinz erklärt, was wir beachten sollten, wenn wir den Nistkasten zuhause aufhängen.
Die Nistkästen sollten ungefähr in Augenhöhe eines Erwachsenen angebracht werden. Die Vögel benötigen einen freien Anflug zu ihrer Höhle. Außerdem darf der Kasten weder zu schattig noch zu sonnig hängen und das Einflugloch sollte von der Wetterseite abgewandt sein, damit es bei einem Sturm nicht hineinzieht und regnet.
In der Werkstatt haben wir uns dann fleißig ans Werk gemacht. Zunächst haben wir die Rückwand und die Seitenwände an den Boden genagelt. Dann kam das Dach drauf und anschließend die aufklappbare Front mit dem Einflugloch. Zum Schluss haben wir Dachpappe auf das Dach genagelt, damit der Kasten lange der Witterung standhält und einen Drahtbügel zum Aufhängen angebracht.
Robin’s Wohnung befindet sich im dritten Stock. Das ist zu hoch für Meisen, aber Mauerseglern gefällt es dort oben. Deshalb hat er einen anderen Kasten gebaut, als die anderen Kinder. Noch eine Besonderheit von Mauerseglern ist, dass sie es gesellig mögen. Deshalb ist Robins Nistkasten ein „Reihenhaus“ mit drei nebeneinander liegenden Höhlen geworden. Emma hat ihm dabei geholfen.
Am Ende haben wir die Nistkästen noch bunt bemalt. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern schützt zugleich das Holz vor dem Regen.
Die Vögel stört die Farbe nicht.
Hier findet ihr Anleitungen für den Nistkastenbau:
Für diesen sonnigen Donnerstag haben wir uns vorgenommen, Weidenpfeifen zu basteln. Früher konnte das quasi jedes Kind, heute ist dieser Zeitvertreib leider bei vielen in Vergessenheit geraten. Wichtig ist natürlich zunächst einmal, dass man auch eine Weide erkennt. Und dann muss man noch zur rechten Zeit den rechten Ast abschneiden. Einer, der genau weiß, wie’s geht, ist Günther Eppler. Er hat uns zusammen mit Gerhard begleitet und uns allerhand gezeigt.
Aber bevor es mit den Weidenpfeifen losging, haben Silas und Robin uns mit einer Zauneidechse überrascht, die sie gefangen haben. Leider habe ich vor lauter Entzücken vergessen, ein Bild davon zu machen. Grün im Sonnenlicht geleuchtet hat sie, und wir haben uns darüber unterhalten, dass sie ein wechselwarmes Tier ist, dass die Sonne braucht um sich aufzuwärmen. Und dass sie bei Gefahr ihren Schwanz abwerfen kann, um ihre Jäger zu irritieren und so zu entkommen. Diesen Trick braucht sie zum Überleben, deshalb dürfen wir nie eine Eidechse zum Spaß dazu bewegen, ihren Schwanz abzuwerfen!
Ah – da sind ja schon die ersten Weiden, die wir auf unserem Streifzug über das Naturschutzzentrumgelände entdecken! Aber – die haben sicher keine Äste, aus denen wir Weidenpfeifen schnitzen können…
Das hier sind Kopfweiden. Die heißen so, weil sie oben so wulstig sind, dass es fast so aussieht, als säße ein Kopf auf dem Stamm der Weide. Sie entstehen, wenn man alle paar Jahre alle Äste abschneidet. Zunächst sehen sie etwas traurig aus, aber die Äste wachsen an anderer Stelle neu. Und in den Schnittflächen entstehen Höhlen, in denen z.B. Fledermäuse wohnen.
Gerhard hat auf dem Weg zu den geeigneten Weiden etwas entdeckt: Erdbienen, die Löcher in die Erde buddeln und ihre Larven dort hinein legen. Damit diese nicht verhungern, bringen sie ihnen noch ein paar Blütenpollen, bevor sie das Loch wieder verschließen. So können sich die kleinen Bienchen gut geschützt entwickeln.
Und noch etwas Spannendes haben wir gefunden: hier wurde ein Vogel gerupft. Die Federn waren graubraun mit leicht grünem Rand. Gerhard vermutet, dass das einmal ein Zilpzalp gewesen ist. Das ist einer der Vögel, die ihren eigenen Namen rufen: zilp-zalp-zilap-zalp.
Wenn ihr auf den Link klickt, könnte ihr ihn hören.
Hoppla, wieder eine Weide entlang unseres Wegs. Aber: diese hier hat so krumpelige Äste, dass sie für Weidenpfeifen auch nicht taugt. Dafür können wir hier die Weidenkätzchen sehen, die Blüten der Weide. Sie blühen ganz früh im Jahr und bieten manchen Insekten ihre erste Nahrung nach der langen Winterruhe.
Aha, hier finden wir also das richtige Holz: langgewachsen und grade müssen sie sein. Und vor allem ganz frisch. Weidenpfeifen kann man nur im Frühjahr basteln, wenn sich die Rinde noch gut vom Holz lösen lässt. Auf diesem Bild seht ihr, wie Gerhard uns die geeigneten Zweige abschneidet.
Wieder zurück auf dem Gelände hat uns Herr Eppler genau erklärt, wie man eine Pfeife baut. Zunächst wird das Mundstück geschnitten, und das Blasloch herausgeschnitzt. Dann trennt man mit dem Messer ringförmig einen Teil der Rinde ab. So etwa vier Zentimeter sind schon genug. Und jetzt wird mit Geduld und Energie mit dem Messergriff auf die Rinde geschlagen – bis sie sich vom Holz löst, und man sie ganz leicht abziehen kann. Dann wird aus dem Holz das Mundstück ausgeschnitten und die Teile der Flöte wieder zusammengesetzt. Hört sich alles leichter an als es dann war – so Mancher von uns brauchte mehr als einen Anlauf um eine funktionsfähige Pfeife hinzukriegen.
Bilder: Doris Heller
Bei unserem Treffen im Mai standen die Vögel im Fokus. Begleitet hat uns wieder Günther Hagemeister von der Ortsgruppe Heppenheim, ein echter Vogelexperte.
Er hatte auch gleich zur Begrüßung etwas völlig Ausgefallenes dabei: das Nest einer Beutelmeise! Da durfte jeder Mal seinen Finger reinstecken. Nicht nur ich war überrascht, wie kuschelig weich das Nest von innen war!
Beutelmeisen bauen ihre Nester aus Samenwolle von Weiden, Pappeln oder Rohrkolben. Günther zeigt uns, wie das Nest aufgehängt war. Meist hängt es an der Spitze eines Weidenzweigs. Den „Aufhängzweig“ und zwei weitere mit eingeflochtene Zweigstückchen kann man an diesem Nest noch sehen.
Beutelmeisen leben an Flüssen und Seen, an denen es Weiden und Pappeln und Schilf gibt.
Und noch ein Nest hat er uns mitgebracht: das Nest einer Kohlmeise. Ein unbefruchtetes Ei ist auch noch drin.
Die Kohlmeise gehört zu den Höhlenbrütern und legt bis zu zwölf weiße, rotbraun gesprenkelte Eier. Dieses Nest stammt aus einem von Günthers Nistkästen.
Dass in dem Nest auch Vögel großgeworden sind, erkennt man daran, dass kleine Schuppen herunterrieseln, wenn man gegen das Nest klopft. Die kleinen Vögelchen haben diese Haut- und Federschuppen verloren.
Bevor wir uns daran machten, die Vögel auf dem Gelände zu beobachten, haben wir abgefragt, welche Vögel ihr schon kennt. Ich muss sagen, ich war überrascht, wie viele das waren! Auf den Tafeln war kaum ein Vogel, den nicht wenigstens einer von euch kannte!
Hier zeigt Günther gerade auf den Gimpel – ihr wisst schon: das ist der Vogel, in den der Räuber Hotzenplotz vom Zauberer Zwackelmann verwandelt wurde. Früher gab es den sehr häufig, da kannte ihn wirklich jeder. Heutzutage ist er leider, wie viele andere Vögel auch, sehr selten geworden.
So, jetzt geht es aber los:
Jeder hat ein Fernglas dabei, und wir haben auch mal kurz geübt, wie man damit umgeht. Erstmal muss man es sich so hinbiegen, dass man beim Durchgucken mit beiden Augen das gleiche Bild sieht, sprich wenn man einen runden Kreis sieht. Wenn das nicht passt, kann man die Gläser dichter zusammendrücken oder ein bisschen auseinander ziehen.
Und dann ist da oben zwischen den Gläsern ein Rädchen. Mit dem stellt man das Bild scharf. Unser Auge stellt sich von alleine auf verschiedene Entfernungen ein, aber so ein Fernglas weiß natürlich nicht, in welcher Entfernung der Vogel sitzt, den wir beobachten wollen.
Der erste Vogel, den wir dann auf dem Wasser der Erlache sehen, ist ein Haubentaucher. Da müssen wir aber schnell sein, denn er taucht immer nur kurz auf, dann ist er wieder unter der Wasseroberfläche verschwunden.
Wir wandern den Weg entlang, und Günther stellt sein Beobachtungsfernrohr, ein Spektiv, auf. Damit können wir die Wanderfalken beobachten, die in dem Nistkasten am Strommasten brüten. Drei Küken sehen wir, die aus dem Kasten lugen. Sie machen schon ein paar Flugübungen und schlagen mit den Flügeln – bald werden sie flügge sein.
Was hat Günther denn da schon wieder entdeckt?!
Im Volksmund wird es Kuckucksspeichel genannt, weil es aussieht, als hätte der Kuckuck, der gerne, aber eher zufällig, in der Nähe solcher Schaumplocken zu beobachten ist, draufgespuckt.
In Wahrheit sitzen aber die Larven der Schaumzikade in diesen Nestern. Die Schaumnester schützen die Zikaden- larven vor Fressfeinden (wer mag schon etwas fressen, das wie Spucke aussieht).
etzt würden wir aber auch gerne noch wissen, wie es in den Nistkästen aussieht.
Hier ist der Starenkasten. Die meisten Vögel tragen den Kot ihrer Babys weg und lassen in irgendwo fallen, damit Raubtiere nicht auf die Idee kommen, dass es in dem Kasten etwas zu holen gibt. Nicht so die Stare. Die kleckern einfach den ganzen Kasten voll.
Ganz anders dagegen das Nest vom Feldsperling. Das ist sauber und kuschelig. Die Kleinen sind aber schon ausgeflogen.
Vielleicht machen sich die Sperlinge bald an eine zweite Brut.
Manche Vögel brüten mehr als einmal im Jahr. Das sind vor allem die kleinen Vögel, für die es den ganzen Sommer lang genug Nahrung gibt. Bei kleinen Vögeln sind die Verluste aber auch recht hoch. Nicht selten wird eine komplette Brut gefressen. Da ist es dann sinnvoll, wenn es mehrere Bruten im Jahr gibt. Sonst hat die Art langfristig keine Überlebenschancen.
Bei unserem Treffen im Juni haben wir uns mit dem Leben in unserer Region vor tausenden von Jahren befasst. Welche Tiere und Pflanzen hier gelebt haben, lässt sich anhand von Fossilienfunden rekonstruieren. Das Kieswerk der Firma Rohr gleich neben dem Naturschutzzentrum fördert nämlich nicht nur Kies an die Erdoberfläche, sondern auch alles, was sich sonst noch darin befindet. Und wir haben das Riesenglück, dass Gerhard Eppler nicht nur ein Experte für solche Funde ist, er darf uns auch in die Kiesgrube führen, damit wir dort selber auf die Suche gehen können.
Und damit wir wissen, worauf wir zu achten haben, hat Gerhard uns zunächst in einer Präsentation einige Dinge gezeigt, die es hier schon gefunden hat. Der Unterkiefer des Mammuts, den er hier in der Hand hält, gehört auch dazu.
Und nicht nur Gerhard hat interessante Fundstücke zum Zeigen: Lara hat in einem Kieshaufen bei sich zuhause etwas gefunden. Gerhard erkennt, dass es die versteinerte Geweihspitze eines Hirschs ist.
Jetzt geht es los:
Wir haben vorher abgemacht, dass wir alle zusammenbleiben. Denn obwohl die Arbeiter in der Kiesgrube mittlerweile Feierabend gemacht haben, ist es nicht ganz ungefährlich, das Gelände zu betreten. Es soll sich ja niemand verlaufen, oder gar in einem der frisch aufgeschütteten Sandhaufen verschwinden!
Und kaum losgelegt, haben wir schon unseren ersten Fund: ein Stück von einem Knochen!
Von welchem Tier der stammt, lässt sich nicht so ohne weiteres sagen. Aber wenn man bedenkt, dass dies ja nur ein Teil vom Knochen ist, muss das Tier wohl ganz schön groß gewesen sein!
Gerhard weist auf die porösen Stellen in der Knochenstruktur hin.
Knochen sind in der Regel von einer festen, glatten Wand umgeben und bestehen im Inneren aus schwammartigen Gewebefasern. Diese geben dem Knochen ihre Stabilität und lassen gleichzeitig Raum für andere wichtige Bestandteile, z.B. dem Knochenmark.
Nach einer Weile geht es weiter zum nächsten Haufen.
Dieser hier ist heute ganz frisch ausgebaggert worden. Deshalb hält Gerhard uns zunächst zurück: die oberste Schicht des Haufens ist relativ sauber, und wir wollen sie erstmal gründlich absuchen, bevor wir anfangen, in den unteren Schichten zu wühlen und womöglich etwas unterbuddeln.
Gerhard dreht die erste Runde unter den gespannten Gesichtern der Kinder und findet…
…einen Zapfen! Der ist pechschwarz, ganz anders als die versteinerten Knochen und Hörner. Der Zapfen ist quasi verkohlt, ohne, dass er gebrannt hat.
Jemand fragt, was er wert sei? Gerhards Antwort macht uns klar: Geld kann man für so einen uralten Zapfen keins bekommen. Aber allein die Vorstellung, dass er vielleicht 30.000 Jahre verschüttet war, und wir die ersten Menschen sind, die ihn überhaupt je gesehen haben, ist doch einfach großartig!
Natürlich finden wir nicht nur Fossilien! Die ausgebaggerten Löcher füllen sich schnell mit Wasser (so ist ja der Erlachsee überhaupt erst entstanden), und hier finden verschiedene Wasservögel einen neuen Lebensraum.
Die Gänse sind wohl gerade in der Mauser. Während der Mauser verlieren Vögel ihre Federn – manche immer nur ein paar, die dann nachwachsen können, bevor sie die nächsten abschmeißen. Andere, wie zum Beispiel die Stockenten, verlieren in sehr kurzer Zeit vieler ihrer Schwungfedern und sind für eine kurze Zeit sogar flugunfähig. Aber ausgetauscht werden müssen die Federn! Sie sind am Ende einer Saison vom Fliegen ganz schön ausgeleiert und an den Enden ziemlich ramponiert. Da müssen dann neue her, bevor die alten Federn ganz im Eimer sind und ihren Besitzer nicht mehr tragen.
Glück für uns: die nächste Indianerparty kann jetzt kommen!
Das war ein sehr interessanter Nachmittag, und wir haben sicher alle viel Spaß gehabt und reichlich dazugelernt.
Bitte beachtet aber:
Das Gelände der Firma Rohr ist ein Privatgelände. Wir durften nur dorthin, weil Gerhard die ausdrückliche Erlaubnis der Besitzer hatte. Auch wenn ihr jetzt wisst, wie man dorthin kommt, und es sicher sehr verlockend ist, nachdem wir gesehen haben, wie viele unentdeckte Schätze dort warten: bitte betretet das Gelände niemals, ohne vorher gefragt zu haben, oder ohne die Begleitung eines autorisierten Erwachsenen!
Bilder und Text: Doris Heller
Im Juli haben wir uns aufgemacht, die verschiedenen Bäume am Naturschutzzentrum einmal genauer zu betrachten. Aufgefallen ist uns dabei vor allem eins: obwohl der Begriff „Baum“ im Kopf schon ein recht genaues Bild erzeugt, unterscheiden sich die Bäume doch sehr voneinander!
Zunächst stellen wir fest, welche Merkmale ein Baum auf jeden Fall aufweisen muss, um ein Baum zu sein: einen Stamm, auf welchem, mit ihren Ästen, Zweigen und Blättern, die Krone sitzt. Damit der Baum nicht umkippt, gräbt er seine Wurzeln in die Erde und hält sich dort fest. Die Wurzeln haben aber noch eine andere wichtige Aufgabe: sie nehmen Wasser und Nährstoffe aus dem Boden auf. Auch die Blätter sind sehr wichtig: in ihnen findet die Photosynthese statt. Hier wird deutlich, wie wichtig Pflanzen, wegen ihrer Größe insbesondere Bäume, für uns Menschen sind. Denn bei der Photosynthese wird das Kohlendioxid (das wir ausgeatmet haben) zusammen mit dem Wasser, das durch die Wurzeln und die vielen Transportkanäle im Holz in die Blätter gelangt ist, Traubenzucker und Sauerstoff erzeugt. Den Traubenzucker braucht der Baum selber – hieraus entsteht neues Holz, der Baum möchte schließlich wachsen. Den Sauerstoff kann der Baum nicht gebrauchen. Ihn stößt er aus, und stellt ihn damit uns zum Atmen zur Verfügung.
Bäume haben auch Blüten, aus denen dann Samen wachsen mittels derer sich der Baum fortpflanzen kann. Manche Bäume, wie die Eiche, setzen darauf, dass hungrige Tiere sich die Samen schnappen und irgendwo fallen lassen oder als Wintervorrat verstecken und dann vergessen. Diese Linde hier hat einen anderen Trick: ihre Samen sind mit einem Hochblatt verwachsen, das wie ein kleiner Flügel wirkt und die Samen im Wind fortträgt.
Jetzt geht es los! Auf dem Naturschutzzentrum und dem angrenzenden Gelände stehen viele Bäume. In Zweier- bis Dreiergruppen sollt ihr möglichst viele verschiedene Blätter finden.
Diese Blätter sehen aber gar nicht gut aus! In diesem Baum sitzt die Schwarze Kirschenblattlaus. Diese kleinen Parasiten stechen mit Saugrüsseln die Blätter an und saugen den Saft heraus. Dort, wo diese Blattläuse vorkommen, sieht man häufig auch Ameisen den Stamm hoch- und runterklettern. Die Ameisen „melken“ die Blattläuse, die ja mit dem zuckrigen Blättersaft vollgesaugt sind. Als Gegenleistung verteidigen die Ameisen die Blattläuse gegen Vögel. In manchen Gärten sieht man deshalb, dass die Stämme der Bäume mit klebrigen Leimringen umwickelt sind. Diese sollen die Ameisen am Hochkrabbeln hindern – und so den Vögeln freien Zugang zu der Nahrungsquelle Blattlaus gewähren. Ein biologischer Pflanzenschutz also, den man auf jeden Fall ausprobieren sollte, bevor man anfängt, Gift gegen die Blattläuse zu spritzen.
Nico zeigt uns noch etwas ganz Gewagtes: er fängt eine Hummel und hält sie zwischen den Fingern, ohne gestochen zu werden!
Das Geheimnis dieser Aktion ist schnell gelüftet! Stechen können nur die weiblichen Hummeln, und wenn man sich, wie Nico, mit Insekten auskennt, erkennt man den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Hummeln. Die Männchen haben nämlich kürzere Fühler. Aber bevor ihr das nachmacht, solltet ihr euch schon sicher sein – ein Hummelstich tut ganz schön weh!
Der Ahorn ist auch ein Baum, der seine Samen fliegen lässt. Wie kleine Propeller segeln sie durch die Luft. Spaltet man die Samen, kann man sie sich auf die Nase klemmen.
Wie immer haben wir nicht nur für unser Thema Augen und Ohren offen! Der Wanderfalke, den wir in diesem Sommer schon ein paar Mal gesehen haben, ist heute auch wieder da und schaut uns vom Strommasten aus zu. Gar nicht so einfach, ihn durch das Fernglas zu entdecken!
Zurück am NZB begutachten wir all die verschiedenen Blätter, die wir gefunden haben. Sie wollen wir in einen Ordner kleben und so ein „Baumbuch“ anlegen. Besser wäre es gewesen, die Blätter erst einmal zu pressen und zu trocknen. Aber da wir nur den einen Termin für Bäume und Blätter haben, improvisieren wir, und kleben die frischen Blätter mit Klebefolie fest.
Damit es schön aussieht, und die Blätter auch gut festkleben, rollen wir sie mit einem Rollholz platt, bevor wir sie festkleben.
Und dann fehlt natürlich noch die Beschriftung. Wir wollen ja schließlich lernen, zu welchem Baum welches Blatt gehört. Dazu hat Nico einige Bücher mitgebracht, in denen wir nachschlagen können. Wir stellen fest, dass es für die verschiedenen Blattformen feste Begriffe gibt, nach denen wir dann im Baumführer suchen können. So werden die Blätter z.B. als herzförmig, gefiedert, eiförmig, gelappt etc. bezeichnet. Es ist auch wichtig, den Blattrand zu betrachten: ist er glatt, wellig, behaart…?
Und je mehr verschiedene Blätter wir auf diese Weise bestimmen, desto faszinierter sind wir über die große Vielfalt, die die Bäume zu bieten haben!
Wenn ihr das nächste Mal mit euren Eltern draußen seid, und ihr seht einen Baum, den ihr gerne bestimmen möchtet, könnt ihr das genauso machen, wie wir heute:
Genau hinschauen, eventuell ein Blatt mitnehmen und zuhause im Buch nachschlagen. Euer Bäumebuch könnt ihr nach Herzenslust weiterführen.
Bilder und Text: Doris Heller
Im September haben wir uns damit beschäftigt, Feuer zu machen. Heutzutage ist das recht einfach, wir nehmen einfach Feueranzünder und ein Streichholz oder Feuerzeug, und schon haben wir immerhin schon mal eine Flamme. Wie aus der dann ein richtiges Lagerfeuer wird, ist an manchen Tagen noch mal eine andere Sache – wenn es stürmt oder regnet, oder das Holz, das man anzünden man anzünden möchte, nass ist, ist auch das eine Herausforderung. Aber noch viel schwieriger ist es, so ganz ohne moderne Hilfsmittel ein Feuer zu entfachen.
Bevor es mit dem Feuermachen losging, habe ich euch noch eine Überraschung mitgebracht: von einem Freund habe ich einen Waldkauz bekommen, der sich in einer Brombeerhecke verfangen hatte, und dort verendet ist. Dadurch, dass der Sommer so heiß und trocken war, ist er nicht verwest, sondern getrocknet und mumifiziert. Es ist beeindruckend, wie weich der Vogel ist. Aber vorsicht bei den Krallen! Als Greifvogel ist der Waldkauz mit messerscharfen Werkzeugen ausgestattet. Als ich ihn in die Tüte zurückgesteckt habe, bin ich nur ganz leicht an eine der Krallen gekommen und hatte gleich einen Schnitt im Finger. Von den hübschen Federn durfte am Ende jeder eine mitnehmen.
Wenn ihr draußen unterwegs seid beachtet bitte, dass man ein totes Tier nicht einfach anfassen sollte, denn zum Einen weiß man oft nicht, woran das Tier gestorben ist, und zum Anderen wird beim Verwesungsprozess Gift freigesetzt. Ein Tier, das normal verwest, stinkt allerdings auch so erbärmlich, dass kaum jemand auf die Idee käme, freiwillig auch nur in die Nähe zu gehen. Von dem getrockneten Waldkauz geht dahingehend keine Gefahr aus, aber auch der kann alles mögliche im Gefieder kleben haben. Deshalb haben wir uns auch die Hände gewaschen, nachdem wir ihn angefasst haben.
Nachdem der Waldkauz wieder verstaut war, ging es endlich mit dem Feuermachen los. Nico hat uns zunächst demonstriert, dass wir auch mit den schönsten Streichhölzern kein solides Holzstück entzünden können. Vielmehr brauchen wir für die ersten Flammen dünne, trockene Ästchen, trockenes Gras oder ähnliches. Und wenn diese dann brennen, könne wir nach und nach dickeres Brennmaterial auflegen, so lange, bis wir ein richtiges Feuer haben.
Zunächst sind wir also auf die Suche nach dem richtigen Material zum Anzünden des Feuers gegangen. Dann standen uns auch noch verschiedene Werkzeuge zum Feuermachen zur Verfügung. Die klassischen Streichhölzer zum Beispiel. Robin hat damit ratzfatz ein kleines Feuerchen in Gang gekriegt.
Wir haben auch die „Strike-anywhere-matches“ ausprobiert, die ich aus Kanada mitgebracht habe. Sie haben einen Kopf aus weißem Phosphor, der sich quasi an jeder rauen Oberfläche entzündet. In Westernfilmen sieht man manchmal, wie sich die Cowboys eine Zigarette anstecken, indem sie das Streichholz an ihrem Stiefel entlangziehen. Diese Streichhölzer werden heute nur noch für solche Späße hergestellt. Die normalen Streichhölzer sind Sicherheitsstreichhölzer, die nur in Kombination mit dem Anrisspapier auf der Streichholzschachtel funktionieren.
Außerdem konnten wir versuchen, mit dem Magnesiumstab Feuer zu machen. Durch die Reibung mit dem Stahl entstehen bis zu 3000°C heiße Funken. Die aber dann auch noch in ein Feuer zu verwandeln ist trotzdem nicht so einfach. Am leichtesten geht es mit Baumwollwatte. Nur, dass die ja meist nicht in unserer Landschaft rumliegt, und dieses Feuerset ja eigentlich für den Abenteurerrucksack entwickelt wurde.
Genauso gut gehen aber auch andere Pflanzen mit wolligem Fruchtstand. Diese Pflanzenwolle bauschen wir ein bisschen auf, bevor wir unsere Funken darauf regnen lassen. Aber dann kommt auch schon die nächste Herausforderung: die Wolle glimmt einmal kurz auf und ist sehr schnell wieder verglüht. Wir müssen schon das nächste Material, sehr trockenes Gras oder sehr feine Hölzchen, parat halten und gleich nachlegen, damit aus den Funken eine Flamme wird.
Und jetzt wird es richtig spannend: Nico zeigt uns, wie man in der Steinzeit Feuer gemacht hat.
Das wichtigste dabei ist die Vorbereitung:
zunächst wird das Brett vorbereitet, auf dem wir bohren wollen. Die glimmenden Späne müssen von dem Brett fallen können, und werden dann auf einer Pappe aufgefangen. Dafür sind die Kerben an den Mulden.
Außerdem soll ja möglichst viel Reibung entstehen, denn durch diese entsteht ja erst die Hitze. Also werden der Stock mit dem gebohrt wird und die Mulde mit dem Messer angeraut. Ganz entscheidend ist auch, dass man sich vorher alles gut zurecht gelegt hat. Denn die Späne wird nur hauchfein glimmen, und braucht sofort Nahrung!
Und dann geht es richtig los: Der Stock wird in den Bogen gespannt, mit einem Stein nach unten gedrückt (um die Hände zu schonen) und dann zieht Nico den Bogen bis es qualmt.
Der Rest geht dann gleichzeitig ganz schnell und doch ganz behutsam. Die glimmende Späne wird zusammengeschüttet, mit einem Hauch Sauerstoff versorgt und in das trockene Gras gegeben. Dann wird das Glutnest hin und her gewogen, wie ein Baby, um ganz vorsichtig den für das Feuer so wichtigen Sauerstoff einzubringen ohne die Flamme auszupusten. Und erst wenn der ganze Grasbüschel brennt, kann Nico gröberes Brennmaterial dazugeben.
Im Oktober haben wir in dem Steinbackofen vom Naturschutzzentrum Igelbrötchen gebacken und dazu einen leckeren Aufstrich aus frischen Kräutern und Frischkäse gemacht.
Wie immer, haben wir uns erstmal begrüßt und ins Thema eingearbeitet. Brot kennt natürlich jeder von uns – aber: woraus besteht es und wie wird es gemacht?
Das Brot hauptsächlich aus Getreide besteht, wissen die meisten ja auch schon. Interessant ist dann aber schon, welches Getreide man wie einsetzen kann. Nicht jedes Getreide eignet sich nämlich zum Brot backen. Da gibt es schon mal Unterschiede zwischen Brot- und Breigetreide. Brotgetreide enthält viel Gluten. Das ist das Klebereiweiß, das in Verbindung mit Wasser aufquillt und einen geschmeidigen Teig entstehen lässt. Dazu gehören z.B. Weizen, Dinkel und Roggen. Ein typisches Breigetreide ist Hafer. Wenn man Hafer mit Wasser mischt, entsteht, wie der Name schon vermuten lässt, Brei. Auch lecker (wenn man Milch und Zucker zugibt) aber leider nicht backfähig.
Wir haben uns an diesem Tag für Dinkelmehl entschieden. Das ist ein Verwandter vom Weizen mit einem leicht nussigen Geschmack. Roggen ist zwar auch ein Brotgetreide, ihn müsste man aber erst versäuern, weil er zu viele Enzyme enthält. Das ist zum einen aufwändig, braucht aber vor allem auch viel mehr Zeit, weil in dem Sauerteig bei unterschiedlichen Temperaturen Essig- und Milchsäurebakterien gezüchtet werden müssen.
Die Körner müssen wir dann erstmal zu Mehl vermahlen. Das können wir mit den steinzeitlichen Mühlen ausprobieren, aber die Menge Mehl, die wir benötigen, lässt sich dann doch leichter in der elektrischen Mühle mahlen.
Für einen einfachen aber leckeren Brotteig brauchen wir neben dem Mehl nicht mehr viel:
Es fehlen nur noch Salz, Hefe und Wasser. Die Hefe dient als Triebmittel. Sie fängt an „zu pupsen“ und bringt so die Luftblasen in den Teig. Das Salz ist vor allem nötig, um dem Brot einen guten Geschmack zu verleihen. Es fungiert aber auch als „Gärkontroller“ und passt auf, dass die Hefe nicht übermäßig viele und große Luftblasen macht. Deshalb dürfen Salz und Hefe nicht unmittelbar miteinander in die Schüssel gegeben werden!
So, wenn die Zutaten in der Schüssel sind, kann es losgehen. Die Ärmel werden hochgekrempelt – Achtung: ihr tut euch keinen Gefallen damit, die Ärmel nur hoch zu schieben, denn dann werden sie euch die ganze Zeit über ärgern und immer wieder runterrutschen! – und dann fangen wir an, den Teig zu kneten.
Vom fertigen Teig bekommt dann jeder ein Stück, um daraus einen Igel zu machen. Dazu wird der Teig erstmal zu einer festen Kugel geformt, indem wir den Teig immer von außen in die Mitte drücken. Die Kugel wird anschließend zu einem Zapfen gerollt. Das ist dann auch schon die Grundform unseres Igelchens. Dem schneiden wir nun mit einer sauberen Schere ein paar Stacheln und wer mag kann dem Igel auch noch Augen aus Rosinen oder Nüssen in den Kopf drücken.
Jetzt müssen die Igelchen nur noch gebacken werden. Im Naturschutzzentrum gibt es dafür den tollen Steinbackofen, den wir schon ein paar Stunden lang mit Holz vorgeheizt haben. In den schieben wir die Bleche jetzt. Da der Ofen kein Thermometer besitzt, müssen wir gut aufpassen und immer mal wieder nachschauen, wie weit das Brot ist, damit es uns nicht verbrennt.
Während die eine Gruppe Igelchen gebacken hat, hat die andere Gruppe mit Margarethe zusammen einen leckeren Kräuter-Frischkäse hergestellt.
Dazu musste sie erstmal frische Kräuter aus dem Garten holen. Diese wurden dann mit der Kräuterwiege fein gehackt und mit ein bisschen Salz in den Frischkäse gerührt. Am Ende wurde der Aufstrich sogar mit ein paar essbaren Blüten (Borretsch) verziert!
Das war wieder mal ein richtig schönes Erlachfuchs-Treffen!
Ach halt, eins noch:
Ich hätte den „Brottest“ fast vergessen, den Günther und Leon gemacht haben! Das war ein kleines Kräftemessen vor und nach dem Brot essen. Und siehe da: Das Brot macht stark – Leon hat Günther beim Armdrücken gepackt!
🙂
Bilder: Albert Jakob, Günther Hagemeister und Doris Heller
Text: Doris Heller
Im November waren wir richtig handwerklich unterwegs – wir haben Futterrahmen gezimmert, die wir mit Vogelfutter gefüllt haben.
Im Winter Vögel zu füttern macht einfach Spaß und ist in manchen (strengen) Wintern sinnvoll und wichtig für unsere Gartenvögel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vogelfutter auszubringen. Das klassische Futterhäuschen ist zwar immer noch sehr beliebt, man hat jedoch festgestellt, dass liegengebliebenes Futter durch Kot und Nässe verunreinigt werden kann und dann dazu beiträgt, dass sich unter den Vögeln Krankheiten ausbreiten. Daher gibt es mittlerweile häufig Futtersilos zu kaufen, in denen das Futter geschützt ist, bis es an die Öffnung rutscht und gefressen wird. Eine weitere saubere Möglichkeit der Vogelfütterung ist die, einen Futterrahmen aufzuhängen. Im Futterrahmen bleiben die Körner, von Fett umschlossen und festgehalten, frei von Vogelkot.
Zusammen mit Nico und Günther haben wir bei diesem Treffen solche Futterrahmen gebaut.
Die Einzelteile für die Futterrahmen hatten wir schon im Vorfeld zurechtgesägt:
Seitenteile. Boden, Dach, Rückwand, Oberdach, Sitzstange und ein zugeschnittener Riemen zum Aufhängen.
Diese Teile haben wir dann zusammengenagelt, während Nico mit ein paar Kindern draußen auf dem Gaskocher das Rinderfett erwärmt hat.
In das Rinderfett haben wir dann die Futtermischung – Sonnenblumenkerne, Streufutter und Haferflocken – gegeben und damit die Rahmen gefüllt. Sobald das Fett fest wird, hält das Futter im Rahmen und kann von den Vögeln herausgepickt werden.
Eigentlich können Vögel ganz gut auf sich selbst aufpassen und auch im Winter ihr eigenes Futter finden. Aber es macht einfach Freude, ihnen beim Fressen und beim Rumturnen an den Futterrahmen zuzuschauen. Und eine Erleichterung ist es für die kleinen Flieger allemal, vor allem wenn man sich unsere aufgeräumten Gärten anschaut, in denen die meisten Pflanzen bereits beseitigt werden, bevor sie die für die Vögel interessanten Teile, die Samen, ausbilden.
In besonders strengen und schneereichen Wintern tun sie sich zudem schwer, geeignete Nahrung unter der Schneedecke zu finden. Da kann es schon sein, dass so ein Futterrahmen für sie zum Lebensretter wird.
Bilder: Günther Hagemeister
Text: Doris Heller
Im Dezember haben wir uns am Vogelpark in Heppenheim getroffen und sind von dort in den Hinteren Bruch gegangen, einem wunderschönen und facettenreichen Naturschutzgebiet.
Das ist nicht weiter schlimm, bzw. sogar von Vorteil, weil sich so keine Prädatoren (Räuber) wie Libellenlarven oder Fische, die eventuell den Laich fressen würden, darin halten können.
Zu dem Hinteren Bruch gehören auch noch eine trockene Kiesfläche, die heute völlig im Nebel liegt, und eine große Schlffläche, die naturgemäß ziemlich feucht-sumpfig ist.
Günther erklärt uns, dass hier vor langer Zeit einmal der Neckar entlang geflossen ist und ein tiefliegendes, feuchtes Gebiet hinterlassen hat. Die unterschiedlichen Lebensraumtypen im Naturschutzgebiet sind entstanden, als die Stadt Heppenheim vor einigen Jahrzehnten angefangen hat, erst Kies aus dem Teil des Bruchs herauszuholen, wo heute der Bruchsee ist, und dann die sumpfigen Gebiete drumherum aufzufüllen, um das Land trocken zu legen und nutzbar zu machen.
Da gerade die sumpfigen Schilfflächen sehr vielen Vogelarten ein zuhause bieten, hat der NABU sich sehr dafür stark gemacht, die Flächen zu erhalten. Seit der Zeit kümmert sich die NABU-Ortsgruppe Heppenheim um den Erhalt und das Fortbestehen dieses Naturschutzgebiets.
Bevor es dunkel wird, wollen wir noch ein bisschen fleißig sein: die Nistkästen, die hier überall auf dem Gelände verteilt sind, müssen vor dem Winter noch gereinigt werden. Das ist wichtig, weil die Vögel im Laufe des Sommers Ungeziefer, wie kleine Milben, in ihre Nester mitgebracht haben. Diese saugen Blut und können die Vögel ganz schön piesacken. Deshalb entfernen wir die alten Nester und mit ihnen alles, was nicht in die Kästen hinein gehört. Außerdem macht es Spaß, anhand der Nester herauszufinden, wer dort gebrütet hat!
Gleich am ersten Kasten wird es interessant: das Nest ist mit vielen Federn ausgepolstert, die alle in eine Richtung zeigen und zur Rückwand des Kastens hin ein wenig nach oben stehen. Das deutet sehr darauf hin, dass in diesem Kasten ein Spatzenpaar gebrütet hat. Lustig ist, dass in dem Kasten eine gelb-rote Feder ist. Die haben die Spatzen bestimmt im Vogelpark nebenan gefunden.
Auch ein Meisennest finden wir. Meisen bauen ihre Nester mit viel Moos. Manchmal findet man auch mehrere Nester übereinander. Dann hat der Kasten wohl den Bewohner gewechselt. In meinem Kasten vor dem Küchenfenster hat in einem Jahr mal eine Kohlmeise angefangen, ein Nest zu bauen, dann kam eine dicke Hummel und hat die kleine Meise vertrieben. Als es dann noch mal kalt wurde, ist die Hummel wieder verschwunden und anschließend hat eine Blaumeise ihr Nest obendrauf gebaut und mindestens sechs Küken ausgebrütet. Ich hatte das Glück, dabei zu sein, als sie ausgeflogen sind und konnte die muntere Familie noch ein bisschen beobachten.
Besonders unappetitlich ist das Nest der Stare. Die kacken nämlich hemmungslos alles voll. Das sieht man dem Kasten schon von außen an – sogar am Einflugloch läuft da schon der Dreck runter. Und Günther erhält umgehend das Verbot, seine Hände später noch in die Keksdose zu stecken.
Als es dunkel und kalt wird, machen wir uns erstmal ein wärmendes Feuer an und stellen Apfelsaft und Kinderpunsch in die Flammen, mit dem wir uns dann aufwärmen können.
Außerdem haben wir Fackeln und alte Stalllaternen mitgebracht, die wir anzünden, als es vollständig dunkel ist. Damit den Hinteren Bruch zu erkunden macht einfach riesigen Spaß!
Am Ende gab es dann noch einen kleinen Weihnachtsgruß für jeden. Und vor allem einen Ausblick auf das nächste Jahr!
Mit den Erlachfüchsen wollen wir im nächsten Jahr ein bisschen mehr in den praktischen Naturschutz einsteigen. Der Hintere Bruch eignet sich besonders gut dafür, denn hier finden sowohl zahlreiche Amphibien (Frösche und Kröten) und Reptilien (Eidechsen und Ringelnattern), als auch sehr interessante Vogelarten einen Lebensraum. Außerdem gibt es jede Menge Fledermäuse, faszinierende Insekten und einige Pflanzen, die wir uns nicht nur anschauen wollen, sondern für die wir „etwas tun“ wollen!
Deshalb wird unser Treffpunkt im nächsten Jahr der Parkplatz am Vogelpark sein. Bei schlechtem Wetter dürfen wir Unterschlupf in der Gaststube suchen und dort basteln, werkeln, Ideen sammeln und austauschen. Bei gutem Wetter gehen wir raus in das Naturschutzgebiet und entdecken, beobachten und erfahren was dort lebt und lernen wie wir der Natur am besten helfen können.
Bilder: Nicolas Chalwatzis
Text: Doris Heller
2016
Bei unserem ersten Treffen in diesem Jahr haben wir uns mit einer Vogelgruppe beschäftigt, die durch ihre nächtliche Jagdaktivität einige besonders spannende Fähigkeiten besitzt: den Eulen.
Und dann haben Eulen auch noch sehr starke und scharfe Krallen, von den vier Fußzehen können sie eine ja nach Bedarf nach vorne oder hinten drehen – so können sie gezielt zupacken und ihre Beute sicher ans Nest bringen.
Albert hat uns ein paar Exponate (ausgestopfte Eulen) mit gebracht, damit wir uns die Unterschiede angucken können. Dieser sibirische Uhu war auch wieder mit dabei. Das Foto ist allerdings schon bei unserer Uhu-Wanderung im Wald entstanden. Der Uhu ist bei weitem unsere größte Eule. Außerdem hatte Albert einen Steinkauz, einen Waldkauz, eine Schleiereule und eine Waldohreule dabei, die ich leider nicht alle fotografiert habe.
Und dann ging es zur Sache: wir haben gelernt, dass Eulen ihre Beute mit Haut und Haaren herunterschlucken. Die Konchen und das Fell (oder auch Federn, wenn die Eule einen Vogel erbeutet hatte) werden im Magen zu kleinen Speiballen, man sagt auch Gewölle, zusammengebappt und wieder ausgewürgt. Wenn man weiß, wo sich eine Eule tagsüber aufhält, kann man unter ihrem sogenannten Tageseinstand diese Gewölle finden und aufsammeln.
Unsere Gewölle hatten wir natürlich gut vorbereitet. Sie waren über Nacht in Alkohol eingelegt, damit keine Keime mehr darin hausen konnten. Außerdem hat jeder ein paar Gummihandschuhe bekommen. Und dann haben wir ganz vorsichtig mit Pinzetten die Gewölle auseinander gepult. Zum Vorschein kamen viele winzige Knochen und Kiefer von Mäusen und anderen Kleinsäugern. Wenn man die Knochen sortiert und vor sich auf dem Tisch auslegt, kann man unter Umständen ein komplettes Mäuseskelett rekonstruieren!
Das ist wirklich spannend. Wissenschaftler erfassen auf diese Art nämlich nicht nur, was eine bestimmte Eule gefressen hat – sie können auch, wenn sie genügend Speiballen aus einer Region gesammelt und untersucht haben, ziemlich genau sagen, welche Kleinsäuger in dieser Region leben. Und das, ohne eine einzige Maus selber gefangen zu haben!
Ganz so akribisch sind wir allerdings nicht vorgegangen. Wir haben die Knochen lediglich in kleinen Schalen gesammelt und uns über die Vielzahl gewundert. Und noch etwas ist uns aufgefallen: einige der Gewölle hat Günther von einem Falkner bekommen, der seine Greifvögel mit Hühnerküken füttert. Diese Gewölle hatten eine ganz andere Farbe. Während die „natürlichen“ Gewölle grau (vom Mäusefell) mit weißen Knochen, schwarzen Käferflügeln und sonstigen Bestandteilen waren, waren die Kükengewölle gelblich, und auch vom Inhalt her monoton. Ein Falkner kann seine Greifvögel und Eulen natürlich nicht anders füttern, aber was man hier sieht gilt nicht nur für Eulen: eine abwechslungsreiche Ernährung macht einfach mehr Spaß!
Zum Schluss haben wir uns draußen noch ein bisschen ausgetobt. Nach so einer fiddeligen Arbeit, wie Gewölle auseinander zu pulen, hat das noch mal richtig Spaß gemacht!
Das war ein wirklich schöner Start in das neue NABU-Jahr. Wir freuen uns auf das nächste Treffen!
Jedes Jahr wählen der NABU und der LBV (Landesbund für Vogelschutz in Bayern) einen „Vogel des Jahres“. Mit dieser Auszeichnung wollen die Naturschützer darauf aufmerksam machen, dass es um unsere Natur an manchen Stellen gar nicht gut steht, und geben Tipps, wie man helfen kann.
Der Vogel des Jahres 2016 ist der Distelfink, oder Stieglitz. Im Namen Distelfink steckt auch schon seine Leibspeise: er braucht zum Leben Samen, z.B. die von Disteln, aber auch anderen „Un“kräutern, die früher an jedem Wegesrand wuchsen. Seit in der Landwirtschaft aber mehr und mehr Unkrautvernichter gespritzt werden, sind nicht nur unsere Feldränder langweilig und öde geworden – vielen Tieren wurde damit auch die Möglichkeit, Nahrung zu finden, genommen. Wir haben uns bei unserem März-Treffen mit diesen schönen bunten Vögeln beschäftigt, und gelernt, was wir tun können, um ihnen und „ihren Freunden“, also allen Vögeln, die sich von Samen am Wegesrand ernähren, und allen Insekten, die diese Pflanzen brauchen, um ihre Eier daran abzulegen und ihre Raupen davon zu ernähren, zu helfen.
Während wir auf euch gewartet haben, hat Nico schon mal unser Spektiv aufgebaut und auf das Storchennest gerichtet, das neben dem Vogelpark auf einem Masten thront. Ein schöner Einstieg, denn der Storch hat das Nest bereits besetzt und uns sogar den Gefallen getan, seiner Frau entgegen zu klappern. Mit dem lauten Schnabelklappern (von dem auch der Name „Klapperstorch“ herrührt) begrüßen sich die Beiden. Die beiden kommen übrigens jedes Jahr wieder in das gleiche Nest und bauen immer wieder ein bisschen daran herum. Über die Jahre kann so ein Horst sehr hoch und sehr schwer werden!
Dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem bunten Distelfink. Er wird auch Stieglitz genannt, weil er in seinem Gesang immer wieder so etwas wie „stieglitt-stieglitt“ singt. Um das herauszuhören braucht man allerdings etwas Fantasie. Aber: Training hilft, auch beim Hören! Wer immer wieder beim Spazierengehen darauf achtet, wie die Vögel singen, der lernt schnell, zumindest die häufigsten Arten voneinander zu unterscheiden. Zum Nachhören und Vergleichen gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten. Im Internet findet man einige Seiten, auf denen Vogelstimmen hinterlegt sind. Meine Lieblingsseite hierzu heißt „Deutsche Vogelstimmen“. Ich habe euch hier mal den Gesang des Distelfinken verlinkt: Gesang vom Stieglitz
Auf unserem Weg um den Bruchsee interessiert uns aber nicht nur der Stieglitz! Wir bleiben gleich am ersten Baum stehen und richten das Spektiv neu aus. Was sitzt denn da? Linus hat seinen Vogelführer dabei, ein Buch, in dem so gut wie alle Vögel, die bei uns vorkommen, abgebildet sind. Das ist ein prima Hilfsmittel, auf das übrigens auch erfahrene Ornithologen zurückgreifen. Denn kaum ein Mensch kennt alle Vögel, zumal sich viele Vögel im Laufe des Jahres verfärben. Jetzt im Frühjahr, wenn sie auf Partnersuche sind, tragen die meisten Vögel (vor allem die Männchen), ihr sogenanntes „Prachtkleid“. Das ist besonders schön und bunt, manchmal auch mit extra eindrucksvollen Federn, denn sie wollen damit ja die Weibchen auf sich aufmerksam machen. Leider ist es als Vogel nicht unbedingt praktisch, leuchtend bunte Farben zu tragen, denn das fällt natürlich nicht nur den Weibchen, sondern auch den Fressfeinden auf. Deshalb färben sich viele Vögel nach der Balz, also, wenn sie eine Partnerin gefunden haben, wieder um in ein unauffälligeres „Schlichtkleid“. Auch Jungvögel tragen meist ein sehr unscheinbares Federkleid. Das ist sicher auch besser so, denn sie müssen ja erst noch lernen, den Gefahren im Leben auszuweichen und gut auf sich aufzupassen.
So kommt es, dass man im Laufe des Jahres schon immer wieder genauer hinschauen muss, wenn man einen Vogel wiedererkennen möchte.
Auf dem Bruchsee schwimmen einige Wasservögel. Auch hier lohnt es sich, genau hinzuschauen. Heute entdecken wir Graugänse, Kanadagänse, Haubentaucher, Blässrallen, Stockenten und Teichhühner. Vor ein paar Tagen haben wir hier noch eine Spießente gesehen. Die hat ganz lange Schwanzfedern, die wie ein Spieß nach oben stehen, wenn sie gründeln.
Auf der Suche nach dem Stieglitz wandern wir einmal um den ganzen Bruchsee. Anfangs haben wir oft angehalten, um etwas zu beobachten. Auf der Westseite des Bruchsees schließen sich feuchte Wiesen, Büsche und Bäume an den See an. Dort gibt es einiges an Leben. Zwar war heute kein Stieglitz da, dafür aber neben den schon erwähnten Wasservögeln jede Menge Blaumeisen, Kohlmeisen, Spechte, Stare, Spatzen, Halsbandsittiche, Krähen, usw.. Sogar einen Kernbeißer haben wir gesehen! Aber hier, auf der Ostseite des Sees, gibt es nur eine öde Ackerfläche, mit nicht als kurzem Grün. Hier haben wir nur ein einziges Mal angehalten – um festzustellen, dass es nichts zu sehen gibt. Klar, auf den Äckern tummeln sich häufig auch Saat- und Rabenkrähen, aber die große Artenvielfalt bieten solche Flächen nicht, soviel steht fest!
Auf dem Rückweg schauen wir noch einmal in unser „Naturparadies“, den Hinteren Bruch. Und schwupp sind alle Ferngläser wieder oben. Hier tummelt sich das Leben überall und es zwitschert lautstark um uns herum.
Bei unserer Weihnachtsfeier durften wir hier noch Feuer machen und durch die Büsche springen – heute geht das nicht mehr. Es ist jetzt „Brut- und Setzzeit“, das heißt, dass viele Vögel schon mit dem Brüten begonnen haben. Und die dürfen natürlich nicht gestört werden. Das gilt übrigens nicht nur für Naturschutzgebiete. Zwischen März und September dürfen gar keine Büsche mehr weggemacht werden, zum Schutz der brütenden Vögel!
So, für heute haben wir genug gelernt. Jetzt darf noch ein paar Minuten gespielt werden. Auf dem Parkplatz liegt ein riesiger Haufen mit Geäst einer gefällten Weide. Da macht das Klettern Spaß!
Oh, halt: Was haben wir denn jetzt gelernt? Auf jeden Fall, dass es sehr schade ist, dass unsere Straßen- und Ackerränder so öde sind und Unkraut entweder weggespritzt oder abgemäht wird. Daran können wir nicht viel ändern, wir können höchstens durch Protest und den Kauf von Bioprodukten darauf aufmerksam machen, dass wir das so nicht wollen. Aber in unserem eigenen Garten, da können wir kräftig mithelfen, dass es dem Stieglitz und seinen Freunden wieder besser geht, indem wir nicht jedes Unkraut gleich rausreißen, sondern so lange stehen lassen, bis sich die Samen gebildet haben, die den Vögeln als Nahrung dienen. Die Stieglitze sind übrigens auch mit Samen von „hübschen“ Blumen oder Samen aus Büschen und Stauden zufrieden. Ein stieglitzfreundlicher Garten muss also nicht unbedingt von Unkraut durchwuchert sein. Ihr könnt das alles noch mal in dem Heftchen nachlesen, dass wir euch mitgegeben haben. Und die Postkarte könnt ihr an einen guten Freund verschicken, oder an jemanden, der einen Garten hat, und dem ihr damit sagen wollt: „Schau mal, solch schöne Vögel könnten auch bei dir wohnen, wenn du ihnen einen Lebensraum anbietest.“
Bei unserem April-Treffen haben wir uns mit Amphibien, also Fröschen, Kröten, Molchen und Salamandern, beschäftigt. Diese haben nämlich den Winter in einer Kältestarre verbracht und werden jetzt langsam wieder aktiv. Im Frühjahr kann man sie gut beobachten, denn dann suchen sie ihre Laichgewässer auf. Im Hinteren Bruch gibt es bereits einige solcher Gewässer, die der NABU vor ein paar Jahren angelegt hat. Einige davon sind aber im Laufe der Zeit auch ausgetrocknet. Die wollen wir heute erneuern und so unseren Amphibien den Lebensraum erhalten.
Bevor wir in den Hinteren Bruch aufbrechen, machen wir uns mit dem Thema vertraut.
Zu den Amphibien (auch Lurche genannt) gehören Frösche, Molche, Unken, Kröten und Salamander. Sie sind Lebewesen, die einen Teil ihrer Lebenszeit im Wasser leben und den anderen Teil an Land. Das funktioniert so:
Die erwachsenen Tiere leben eigentlich an Land, kommen aber im Frühjahr ans Wasser, um dort ihren Laich, also ihre Eier, abzulegen.
Im Bild oben seht ihr den Laich von einem Grasfrosch. Es ist faszinierend, wie viele Eier aus so einer kleinen Froschdame herauskommen: zwischen 700 und 4.000 Eier setzt sie ins Wasser! Diese quellen dann auf und sind mit einer glibberigen Schutzhülle umgeben, bis aus den Eiern Kaulquappen schlüpfen. Kaulquappen sehen aus wie kleine Kugeln mit Schwanz dran und atmen mit Kiemen im Wasser. Im Laufe der nächsten Wochen bzw. Monate wachsen den Kaulquappen Beine, der Schwanz wird immer kürzer und verschwindet irgendwann (außer bei den Molchen und Salamandern, das sind sogenannte „Schwanzlurche“, die ihren Schwanz behalten) und sie entwickeln Lungen, um Luft atmen zu können. Aber auch, wenn sie zu Lungenatmern geworden sind, sind sie immer noch sehr auf Wasser angewiesen. Ihre Haut ist sehr dünn und sie vertrocknen, wenn sie es nicht feucht genug haben. Deshalb findet man auch nach der Eiablage noch viele Amphibien, darunter vor allem Molche und einige Froscharten, in der Nähe von Gewässern. Die meisten Amphibien sind aus diesem Grund auch nachtaktiv: sie sind dann weniger gefährdet, auszutrocknen.
So, genug der Theorie, jetzt geht es los: Wir haben im Vorfeld Reusen gelegt, in der Hoffnung, euch ein paar Amphibien aus dem Hinteren Bruch vorstellen zu können. Aber Achtung: Amphibien stehen unter Naturschutz und dürfen nicht einfach so gefangen werden. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung von der Unteren Naturschutzbehörde, die uns erlaubt, Amphibien zu Forschungs-zwecken (in unserem Fall Bestandserfassung) zu fangen. Solche Genehmigungen bekommt man, wie der Name schon sagt, nur im Ausnahmefall – anderenfalls ist es verboten, Amphibien einzufangen.
Tatsächlich ist uns ein Tier in die Falle gegangen! Nun versuchen wir, mit einem sogenannten „Bestimmungsschlüssel“ herauszufinden, um welches Tier es sich handelt. Mit einem Bestimmungsschlüssel arbeitet man folgendermaßen: Es werden nacheinander Informationen abgefragt, die dann in der Summe der Ergebnisse auf das richtige Tier schließen lassen. Der Anfang ist noch ganz einfach: Hat das Tier einen Schwanz? Bei „ja“ geht es weiter bei Frage M, bei „nein“ geht es weiter mit Frage „B“. Unser Tier hat einen Schwanz, wir können also gleich sagen, dass es sich um einen Schwanzlurch handelt. Also weiter mit Frage „M“: Glänzt die Haut wie lackiert, oder ist sie anders?
Auf diese Weise folgen wir dem Schlüssel bis herausgefunden haben, dass wir da ein Teichmolchweibchen vor uns haben. Einen Online-Bestimmungsschlüssel zum ausprobieren findet ihr unter diesem Link: Bestimmungsschlüssel.
Bestimmungsschlüssel gibt es zu allen möglichen Tieren und Pflanzen. Viele davon stehen im Internet zur Verfügung. Probiert doch einfach mal den einen oder anderen aus!
Auch wenn Lena der Abschied ein wenig schwer fällt: unsere Teichmolchdame lassen wir natürlich anschließend wieder frei.
Dann machen wir uns an die Arbeit, wir wollen schließlich noch etwas tun für unsere Amphibien.
Wir suchen uns zwei der ausgetrockneten „alten“ Wasserlöcher aus, und fangen an, diese aus zu heben. Ganz schön harte Arbeit, wie gut das unsere Kindergruppe so stark ist!
Thema des heutigen Treffens sind Schmetterlinge. Die meisten Menschen kennen die typischen Frühlingsboten wie Admiral, Tagpfauenauge oder Zitronenfalter ja und freuen sich darüber, wenn sie die bunten Falter auf ihren Gartenblumen Nektar saugen sehen.
Aber ganz so leicht, wie es aussieht, haben es unsere Schmetterlinge gar nicht. Deshalb wollen wir euch heute die vielfältigen Lebensweisen ein bisschen näher bringen.
Aber bevor wir damit loslegen, schauen wir erst einmal nach unseren Teichen vom letzten Mal. Es hat inzwischen einige Male geregnet und die Tümpel haben sich ganz gut gefüllt. Es ist auch ein bisschen Erdmaterial eingeschwemmt worden, so dass sie jetzt nicht mehr so steril aussehen.
Amphibien sind noch nicht in Sicht, die Frösche schwimmen noch im Nachbarteich, aber das war auch nicht wirklich zu erwarten. Zufrieden können wir auf jeden Fall sein, mit unserer Arbeit!
Dann starten wir mit unserem eigentlichen Thema. Exemplarisch für das faszinierende Leben der Schmetterlinge nehmen wir den Zitronenfalter, der eine besondere Eigenschaft hat: er st der einzige Tagfalter in Deutschland, der einfach frei hängend in Wind und Wetter überwintert. Diese faszinierende Fähigkeit verdankt er einer speziellen Zusammensetzung seines Blutes, welches mit Glycerin angereichert ist. Er trägt also sozusagen ein Frostschutzmittel in sich, das ihn vor dem Erfrieren schützt.
Dementsprechend ist er auch einer der ersten Falter, die wir im Frühjahr zu Gesicht bekommen. Andere Schmetterlinge, die als Falter überwintern, wie der Admiral oder das Tagpfauenauge, verkriechen sich in frostsichere Verstecke. Wieder andere Falter überwintern als Ei (z.B. Nierenfleck), Raupe (z.B. Schillerfalter) oder Puppe (z.B. Schwalbenschwanz).
Der Entwicklungszyklus eines Zitronenfalters beginnt mit einem, an einem Faulbaum abgelegten, Ei. Aus diesem Ei schlüpft nach ein bis zwei Wochen eine kleine Raupe, die die nächsten Wochen mit fressen verbringt. Die Raupen sind extrem gut getarnt und legen sich gerne entlang der Blattadern. Auf diese Weise verschmelzen sie optisch quasi mit ihrem Untergrund. Je nach Witterung dauert es zwischen drei und sieben Wochen, bis die Raupe groß genug ist, sich zu verpuppen. Nach weiteren zehn Tagen schlüpft dann der fertige Schmetterling.
Die Geschlechter der Zitronenfalter unterscheiden sich deutlich in der Farbe: während das Männchen das namensgebende Zitronengelb trägt, ist das Weibchen eher mintgrün gefärbt.
Die fertigen Falter saugen Nektar aus zahlreichen Blüten und sind dahingehend unkompliziert. Schwierig wird es für unsere Schmetterlinge erst, wenn sie ihre Eier ablegen möchten. Da sind nämlich die meisten Falter ausgesprochene Spezialisten. Die Zitronenfalterraupe benötigt z.B. Faulbaum, der schöne große Schwalbenschwanz legt seine Eier ausschließlich auf Fenchel oder Wilder Möhre bzw. wenigen anderen Doldenblütlern ab.
Wenn wir also Schmetterlinge schützen möchten, müssen wir dafür sorgen, dass ihre Raupen die richtige Nahrung finden können. Am besten informiert man sich gezielt darüber, welche Pflanzen man, neben den schönen und beliebten Blühpflanzen, unbedingt in seinen Garten setzen sollte!
Schön sind auch die Marienkäfer, die wir auf dem Parkplatz finden. Hier paart sich ein schwarzer mit roten Punkten mit einem roten mit schwarzen Punkten. Wie die Babys wohl aussehen werden, die da rauskommen? Interessant wäre das schon, aber bis es soweit ist, dass neue Marienkäfer daraus werden, durchlaufen auch diese Insekten erst mehrere Entwicklungsstadien. Die Larven der Marienkäfer sind bei Gärtner übrigens ungemein beliebt, denn sie verschlingen bis zu 50 Blattläuse am Tag. In seinem ganzen Leben, kommt ein Marienkäfer auf bis zu 1.000 verspeister Blattläuse!
Dann fängt es mal wieder an zu regnen, und wir verkriechen uns schnell im Vogelpark. Hier zeigen wir euch ein paar Bilder von unseren heimischen Tagfaltern. In einem anschließenden Quiz könnt ihr testen, wie viel ihr davon behalten habt.
Gott sei Dank hat war es nur ein kurzer Schauer, und wir können nach dem Quiz wieder raus! Hier halten wir noch mal Ausschau nach Insekten, die uns auffallen. Diese Ameise kletterte munter auf den Blüten der Taubnessel umher.
Die Taubnessel sieht fast aus, wie die Brennnessel. Sie unterscheiden sich aber deutlich in ihren Blüten. Die der Taubnessel kann man auch aussaugen, indem man sie vom Stängel zupft und am Kelch saugt. Dann schmeckt man den süßen Nektar. Das probieren wir aber nicht mit den Parkplatzblumen aus – wer weiß, wie viele Hunde dort schon das Bein gehoben haben…
Zum Abschluss drehen wir noch eine Runde um den Bruchsee. Die Kanadagänse haben sechs Küken, die sie über den See führen. Viele Schmetterlinge bekommen wir aber nicht mehr zu Gesicht. Es wird wohl höchste Zeit, dass wir alle etwas für unsere Tagfalter tun, und ihre Lebensräume mit den richtigen Pflanzen schützen und fördern! Tipps zu diesem Thema findet ihr auch unter https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/aktivitaeten/schutz.html.
Im Landkreis Bergstraße brüten zehn verschiedene Greifvogelarten. Einige davon sieht man häufig über unseren Feldern auf der Jagd, andere leben heimlich im Wald und man bekommt sie kaum zu Gesicht. Oder sie sind so rasante Jäger, dass man schon im richtigen Augenblick hinschauen muss, um sie zu beobachten. Wir haben uns bei unserem Juni-Treffen mit den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden der einzelnen Arten beschäftigt.
Zunächst wollen wir natürlich von euch wissen, welche Greifvögel ihr schon kennt. Schnell kommt auch die Frage auf, ob die Eulen auch dazu gehören. Eine gute Frage, denn Eulen und Greife haben vieles gemein: sie sind alle miteinander Jäger, die ihre Beute mit den Fängen schlagen und dann mit ihrem scharfen, gebogenen Schnabel aufreißen und fressen. Der Unterschied zwischen Eulen und Greifvögeln ist vor allem die Tageszeit, zu der sie aktiv sind. Während Eulen, bis auf wenige Ausnahmen, nachts jagen, sind unsere Greifvögel tagaktiv.
Unsere Greifvögel lassen sich wiederum in Gruppen einteilen. Da gibt es Falken, Milane und Weihen und Habichtartige. Adler und Geier, die auch zu den Greifvögeln zählen, gibt es an der Bergstraße nicht, bzw. nicht mehr.
Günther hat uns ein paar präparierte heimische Greifvögel mitgebracht, an denen er uns die wichtigsten Merkmale der einzelnen Vögel erklärt.
Zunächst wird Rebecca als Schriftführerin gewählt. Sie hat eine schöne Handschrift und notiert gewissenhaft alles, was es zu den Greifvögeln zu sagen gibt. Da hat sie ganz schön zu tun, denn aus der Nähe betrachtet unterscheiden sich unsere Greifvögel doch arg!
Als erstes zeigt uns Günther einen Sperber. Sperber jagen kleine Vögel im Flug. Um sie greifen zu können, hat er lange schlanke Beine. Der Schnabel des Sperbers ist nicht besonders groß und kräftig – gerade so, wie er ihn für seine zarten Beutetiere braucht.
Bei Sperbern ist das Weibchen deutlich größer als das Männchen. Beide weisen eine Querbänderung an der Unterseite auf, wobei das Männchen eher rostbraun, das Weibchen grau-braun ist. Sperber sind rasante Flieger mit schnellem Flügelschlag. Sie kommen häufig bei uns vor, es braucht aber ein bisschen Übung, einen Sperber zu erkennen, wenn er mit schnellem Flügelschlag vorbeisaust.
Dem Sperber sehr ähnlich ist der Habicht. Er ist größer und jagt taubengroße Vögel, denen er von einer Sitzwarte her auflauert. Dies geschieht meistens im Wald, daher bekommt man den Habicht nur selten zu Gesicht. Besonders eindrucksvoll sind seine kräftigen Fänge, mit denen er sich seine Beute schnappt. Früher wurde er Hühnerhabicht genannt, weil er sich auch ganz gerne mal ein Huhn geholt hat. Dafür wurde er leider gnadenlos bejagt und sein Bestand hat drastisch abgenommen. 2015 wurde er zum Vogel des Jahres gekürt, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es immer noch gewissenlose Jäger gibt, die dem Habicht und anderen Greifvögeln nachstellen und fies umbringen.
Der Habicht hat einen „Reißhaken-Schnabel“, mit dem er Fleischstücke aus seiner Beute reißen kann. Wie man im Bild gut sehen kann, sind seine Fänge deutlich kräftiger als die vom Mäusebussard (links Bussard, rechts Habicht).
Unseren Mäusebussard kennt jeder. Ihn sieht man oft am Himmel kreisen und nach Mäusen Ausschau halten. Manchmal kann man beobachten, wie Krähen hinter ihm herfliegen und ihn am Schwanz ziehen. Dieses Verhalten nennt man „hassen“. Da Bussarde und andere Greifvögel potenziell gefährlich für die Krähenbrut sind, versuchen sie ihn so zu vertreiben.
Auch den Turmfalken kennt bei uns jeder. Er kann etwas, was die anderen Greifvögel nur äußerst selten tun: er „rüttelt“ gerne. Das bedeutet, dass er so mit den Flügeln schlägt, dass er auf der Stelle in der Luft steht. Das verbraucht zwar viel Energie, dafür kann er aber auch genauer hinschauen, wenn er etwas interessantes gesehen hat, und sich dann blitzschnell auf die Beute – meist eine Maus oder eine Eidechse – stürzen. Diese tötet er dann mit einem kräftigen Biss in den Nacken. Für diese Art zu töten braucht er einen besonderen Schnabel. Mit seinem sogenannten „Falkenzahn“, einem Vorsprung im Oberschnabel, kann er die kleinen Genicke gut knacken. Diesen Falkenzahn haben alle Falkenarten, weshalb sie innerhalb der Greifvögelsystematik eine eigene Ordnung zugesprochen bekommen haben.
So, für’s erste haben wir genug gelernt! Jetzt wollen wir noch in den Hinteren Bruch gehen, und dort mal in die Nistkästen schauen. Mittlerweile ist der Hintere Bruch ziemlich zugewachsen. Überall Brombeeren und Brennnesseln – da müssen wir uns ganz schön den Weg freikämpfen!
In diesem Nistkasten hat ein Feldsperling gebrütet. Das erkennt man an der vielen Federn, die er in sein Nest mit eingebaut hat. Da sind sogar ein paar rosa Federn dabei. Die haben die Spatzeneltern bestimmt bei den Flamingos im Vogelpark nebenan gefunden!
So richtig unappetitlich sieht es dann im Starenkasten aus. Alles vollgesch… haben die kleinen Stare. Da kommt auch wenig Lust auf, noch eine zweite Brut in diesem Kasten anzufangen – er muss definitiv erst gereinigt werden.
Die Meisen und die Spatzen gehen da doch deutlich pfleglicher mit ihren Nistkästen um. Sie benutzen ihre Nester auch gerne für eine zweite Brut.
Und dann zeigt uns Günther noch den Fingerhut und erzählt uns die Geschichte von einem Arzt, der eine sterbenskranke Frau besucht hat, für die er nicht mehr viel tun konnte. Ein paar Wochen später hat er die gleiche Frau wieder munter draußen herumspringen sehen. Da hat er sich sehr gewundert, und die Frau gefragt, wie sie so schnell wieder gesund werden konnte. So kam ans Licht, dass eine Kräuterfrau, die sich offenbar sehr gut auskannte ihr geholfen hatte, indem sie sie mit dem Fingerhut behandelt hat. Und seitdem ist bekannt, dass der Fingerhut gegen Herzleiden hilft.
Natürlich muss man sich mit Kräutern gut auskennen, wenn man sie zur Behandlung von Krankheiten benutzen möchte. Manche Kräuter sind giftig, wenn man zu viel davon nimmt, oder sie zur falschen Zeit einsetzt. In der heutigen Zeit ist es also allemal besser, vorsichtshalber einen Arzt zu fragen, bevor man sich selbst behandelt.
Bei unserem September-Treffen haben wir uns mit Heilpflanzen beschäftigt. Viele der Pflanzen, die um uns herum wachsen, können sehr nützlich für uns sein. Schon seit vielen tausend Jahren nutzen die Menschen die Inhaltsstoffe von bestimmten Pflanzen, um wieder gesund zu werden. Und selbst wenn Leute glauben, sie greifen lieber zu einer Pille, stecken meist die Kräfte der Pflanzen hinter dem Geheimnis des Wirkstoffs – nur, dass er heutzutage industriell gewonnen oder synthetisch hergestellt und haargenau dosiert und in Tabletten, Säfte oder ähnliches gemischt wird.
Um die Pflanzen zu finden, sind wir erstmal in den Wald gelaufen. Dort an den Waldwegen und auch draußen an den Feldern, wachsen sie, unsere Heilkräuter, völlig unscheinbar und meist nur wenig beachtet. Wie viele verschiedene Kräuter wir hier wohl finden werden?
Das erste, das uns auf unserem Weg begegnet ist der Schwarze Nachtschatten. Nachtschattengewächse sind generell giftig und nur unter bestimmten „Bedingungen“ essbar. Kartoffeln zum Beispiel zählen auch zu den Nachtschattengewächsen. Sie sind giftig, wenn man sie roh verzehrt. Wir essen bei der Kartoffel ja auch nicht die Früchte, sondern die Knollen, in denen die Kartoffel Stärke zum Wachstum der neuen Kartoffelpflanze speichert.
Vom Schwarzen Nachtschatten wurde früher während der Blütezeit das Kraut gesammelt und Tee gegen Verdauungsbeschwerden daraus gekocht. Aber im Falle des Nachtschattens solltet ihr aufgrund seiner Giftigkeit doch lieber auf andere Kräuter ausweichen, wenn euch mal schlecht ist. Da gibt es bekömmlichere Mittel, mit denen ihr bei einer Selbstmedikation weniger falsch machen könnt!
Das nächste Heilkraut in unserer Sammlung ist das Schöllkraut. Schöllkraut gehört zu den Mohngewächsen. Es ist sehr bitter und wird eigentlich nur noch äußerlich angewandt. Wenn man das pflückt, kommt aus dem Stängel ein gelber Saft. Den verwendet man gegen Warzen. Einfach mehrmals täglich die Warze damit betupfen – das ordnen sogar heute noch manche Ärzte an.
Die nächste Pflanze, die wir gefunden haben, kannte bereits jeder. Doch dass aus Efeu ein ganz toller Hustensaft gewonnen werden kann, war noch nicht jedem bewusst.
Uh, Brennnesseln… Das mag man sich nicht so gerne vorstellen, dass man einen Tee aus Brennnesseln trinken soll. Doch ganz ehrlich, er hilft zum einen gegen Magenverstimmungen, und er entwässert den Körper. Wenn jemand also dicke Beine kriegt, weil sich Wasser im Körper eingelagert hat (das kommt zum Beispiel bei schwangeren Frauen häufig vor), dann wirkt Brennnesseltee Wunder. Und man kann nicht viel verkehrt machen – von einer Überdosis an Brennnesseltee habe ich zumindest noch nie gehört. Im übrigen kann man aus jungen Brennnesseln auch eine ganz leckere Suppe kochen. Die brennen natürlich nicht mehr wenn sie gekocht sind, sonst wäre die Suppe bestimmt kein Genuss.
Hier haben wir Gundermann, oder auch Gundelrebe genannt. Gundelrebe schmeckt ganz klasse im Salat. Er enthält Bitterstoffe und ätherische Öle und wurde früher auch zum Haltbarmachen von Bier verwendet. Außerdem soll er gegen Kopfschmerzen und sogar Lungenentzündung helfen – wobei man bei einer Lungenentzündung besser auf die Medikamente zurückgreift, die der Arzt verschreibt!
Und Achtung an alle ReiterInnen unter euch: für Pferde und viele Nagetiere ist Gundermann giftig!
Da wächst noch ein Hustensaft – oder zumindest ein enger Verwandter. Eigentlich haben wir nach dem Spitzwegerich gesucht. Gefunden haben wir den Mittleren Wegerich, der fast genauso aussieht, nur breitere Blätter hat. Kocht man die Blüten und die Blätter vom Spitzwegerich mit Zucker oder Honig auf, erhält man einen leckeren und sehr wirksamen Sirup gegen Hustenreiz.
Die Blütenstände vom Wegerich wurden früher auch „Himmelsbrot“ genannt, weil man sie essen kann und sie geschmacklich ein wenig an Brot erinnern. Das könnt ihr gefahrlos ausprobieren, Wegerich ist nicht giftig. Allerdings solltet ihr beim sammeln darauf achten, dass ihr nicht gerade an einer Hunde-Gassi-Strecke landet.
Diese Pflanze kennt auch jeder: klar, das ist Löwenzahn. Aber wisst ihr auch, wofür, bzw. wogegen man ihn verwenden kann? Er enthält Bitterstoffe, die bei Verdauungsbeschwerden helfen. Wenn man so ein vollgestopftes Gefühl im Bauch hat, dann kann man zum Beispiel ein paar frische Löwenzahnblättchen zum Nachtisch essen (oder man verzichtet von vorneherein darauf, mehr zu essen, als in den Magen rein passt ;-)).
Abgesehen davon ist Löwenzahn bei Imkern besonders beliebt, weil er früh im Jahr blüht und nach dem Winter eine wichtige Nahrung für Honigbienen ist.
So, jetzt ist erstmal genug gelernt. Schwuppdiwupp sind alle Kinder im Mais verschwunden…
Unglaublich, wie gut man sich hinter nur zwei Reihen Maispflanzen verstecken kann!
Und weiter geht es mit der Kräuterkunde: Die Echte Kamille enthält ätherische Öle, die ganz besonders duften. Wer einmal daran geschnuppert hat, vergisst den Geruch so schnell nicht wieder.
Aus Kamillenblüten kann man einen Tee gegen Magen- und Darmbeschwerden kochen. Außerdem kann man damit inhalieren, wenn man eine Nebenhöhlenentzündung hat.
Hier sehen wir noch den Stechapfel. Er gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist SEHR GIFTIG! Wie gut, dass er sowieso nicht besonders appetitlich aussieht. Die Pharmaindustrie hat Methoden entwickelt, daraus einen Wirkstoff zu gewinnen, der Krämpfe bei Asthmaanfällen lösen kann. Aber das ist eindeutig was für Profis – wir lassen die Finger vom Stechapfel!
Jetzt wird es langsam Zeit, zurück zu gehen. Wir wollen uns unsere Fundstücke ja schließlich auch noch in Ruhe angucken, und noch mal wiederholen, was wir alles gelernt haben!
Unsere gesammelten Heilpflanzen nehmen wir mit in den Vogelpark und zählen erstmal nach. Wir haben sage und schreibe 22 verschiedene Kräuter und Heilpflanzen auf unserem Weg gefunden.
Die ordnen wir jetzt noch nach Namen auf dem Tisch und staunen über die Vielfalt.
Günther erklärt uns dann auch noch ein paar Dinge über die Geschichte der Medizin. So zum Beispiel, dass das Chinin, ein Medikament gegen die wirklich fiese, mit hohem Fieber einhergehende, Tropenkrankheit Malaria, dadurch entdeckt wurde, dass man kranke Lamas dabei beobachtet hat, wie sie die Rinde des Chinarindenbaumes gefressen haben um ihr Leid zu lindern.
Und das Beste kam zum Schluss:
Zum Abschied hat Betty, die gute Seele vom Vogelpark, jedem Kind, das noch da war, eine Pfauenfeder geschenkt!
Bei unserem Treffen im Oktober wollen wir uns mit ganz besonderen Säugetieren beschäftigen: mit unseren heimischen Fledermäusen.
Aber bevor wir mit diesem Thema loslegen, bekommen wir von Betty noch eine Tour durch den Vogelpark! Das ist prima, denn Betty ist hier die gute Seele des Parks, sie füttert die Vögel täglich und kennt jeden einzelnen Vogel der hier lebt ganz genau.
Zunächst kommen wir bei den Singschwänen vorbei. Singschwäne sind im Norden, in der osteuropäischen und sibirischen Taiga, zuhause und sind bei uns nur während des Vogelzugs, und dann auch nur mit Glück, zu sehen.
Sie haben ihren Namen von ihrer Eigenart, besonders gerne Laute von sich zu geben. Das tun sie auch, als sie uns, bzw. Betty, sehen und sorgen damit für große Erheiterung.
Wir dürfen auch zu den Nandus in das Gehege. Die kommen auch gleich ganz neugierig zu uns herüber. Betty zeigt auf die imposanten Füße der Beiden und erklärt, dass die Nandus sich sehr gut damit zu wehren wissen: sie treten damit und zerkratzen potenziellen Angreifern die Beine oder schlimmeres. Das möchte keiner von uns ausprobieren – zum Glück sind die Nandus hier ganz lieb und nur ein bißchen neugierig.
Dann zeigt uns Betty noch zwei riesige Eier: ein creme-weißes und ein grünes mit einer ganz rauen Schale.
Das weiße stammt vom Nandu, das grüne vom Emu.
Emus sind in Australien zuhause. Das Emuweibchen legt bis zu 15 (!) dieser großen Eier. Nandus kommen aus Südamerika. Es gibt auch ein paar entflohene Nandus, die jetzt wild in Mecklenburg-Vorpommern leben und sich dort auch recht gut vermehren.
Zum Schluss zeigt uns Betty noch ein paar Federn, die sie aneinander reibt.: es sind auch Uhufedern dabei, die völlig lautlos durch die Luft gleiten.
Diejenigen, die im Frühjahr dabei waren, als wir über Eulen gesprochen haben, wussten auch gleich Bescheid: Eulen haben an den Federn der Handschwingen kleine Fortsätze, die die Luft entlang der Flügelkante verwirbeln und so jedes Geräusch unterbinden. Deshalb können Eulen sich auch im Dunkeln lautlos ihrer Beute nähern.
Dann geht es mit unserem eigentlichen Thema los: Fledermäuse. Fledermäuse sind nicht nur sehr interessante Tiere – sie sind auch unglaublich vielfältig. Deshalb haben wir Angelika eingeladen, eine richtige Fledermausexpertin, die sich schon lange mit Fledermäusen beschäftigt und uns viel darüber erzählen kann.
Angelika hat einen kleinen Vortrag für uns vorbereitet, in dem sie uns von den Besonderheiten der Fledermäuse berichtet:
Die Fledermäuse, die bei uns leben, sind allesamt dämmerungs- oder nachtaktiv und sind entsprechend selten vor der Abenddämmerung zu beobachten. Sie haben winzige Augen, und orientieren sich über ein Ultraschallsystem. Sie senden Signale aus, die, wenn sie auf ein Hindernis treffen, zurückgeworfen werden und von der Fledermaus zu einem Bild verarbeitet werden. Da sie allerdings nicht ununterbrochen Signale senden können, ergibt sich vermutlich in ihrem Kopf ein ähnliches Bild, wie wenn wir ganz schnell hintereinander das Licht an- und wieder ausschalten würden. In Discos und auf Feiern wird so etwas manchmal gemacht. Dann sehen die Bewegungen irgendwie abgehackt aus. Wenn man es nicht gewohnt ist, so zu sehen, wird einem aber auch schnell mulmig dabei.
Viele Fledermausarten haben ganz eigenartige Gesichter. Die Hufeisennase zum Beispiel hat eine riesige Nase, die aussieht wie ein Hufeisen. Oder die Mopsfledermaus, die hat ein zerknautschtes Gesicht – wie ein Mops. Man nimmt an, dass diese putzigen Gesichtsformen dabei helfen, den Schall zu lenken, als wichtig für das Gehör und die Ortung sind.
Und die Echoortung ist nicht das einzig interessante an Fledermäusen! Im Gegensatz zu uns, die den Kopf immer oben halten, hängen sich Fledermäuse an ihren Füßen auf, mit dem Kopf nach unten. Deshalb haben Fledermauskästen auch unten das Einflugloch.
Ansonsten sind Fledermäuse so vielfältig, dass man kaum mehr alles beschreiben kann, schon gar nicht in einem kurzen Artikel. Es gibt Arten, die im Wald leben, welche, die sich in der Stadt zuhause fühlen. Wasserfledermäuse, die, wie der Name schon sagt, über dem Wasser jagen, während andere quasi am Boden auf Käferjagd gehen. Viele Fledermäuse orientieren sich an Leitlinien in der Landschaft. Das können Straßenzüge sein, oder aber Baumreihen. Und wenn diese dann aus irgendeinem Grund abgeholzt werden, fehlt den Fledermäusen plötzlich die Orientierung. Deshalb sprechen sich Naturschützer in der Regel gegen die Abholzung ganzer Baumreihen aus. Zumal viele, gerade alte, Bäume Höhlen anbieten, in denen nicht nur Vögel, sondern auch Fledermäuse gerne Zuflucht suchen. Es gibt auch Fledermäuse, die sich bloß in kleine Rindentaschen drücken, wie die Mopsfledermaus. Aber solche Wohnungen sind nicht sehr stabil, deshalb zieht die Mopsfledermaus auch ständig um. Dann klemmen sie sich ihre Babys unter den Arm und suchen sich eine neue Bleibe.
Wir wollen heute auch noch Fledermauskästen selber bauen. Wir haben von Angelika gehört, dass vor allem Zwergfledermäuse in solche Kästen am Haus gehen. Es kommen aber auch andere Arten darin vor.
Eines ist noch ganz wichtig, zu erwähnen: Fledermäuse haben arg spitze Zähne. Während man die Zwergfledermaus gefahrlos auf die Hand nehmen kann, sollte man sich bei allen anderen Arten unbedingt dicke Handschuhe anziehen, zumal bei Bissen auch Krankheiten übertragen werden können. Überraschend fand ich Angelikas Ausführung, dass die meisten Fledermausarten, wenn sie mal auf den Boden gefallen sind, nicht mehr von dort losfliegen können. Wenn man also eine Fledermaus findet, die am Boden liegt, sollte man sie irgendwo hinsetzen, wo sie wieder gut starten kann.
Da sind schon ein paar sehr schöne Kästen entstanden. Wir sind gespannt, ob sie angenommen werden – denn auch darüber können Fledermausexperten noch keine valide Aussage treffen. Die Fledermäuse machen einfach, was sie wollen…
Aber immerhin hat man schon herausgefunden, dass sie es ein bißchen wärmer mögen, und der Kasten nicht an der Nordwand hängen sollte. Wir haben auch in die Kästen ein paar Querleisten eingefügt. So haben die Mäuschen quasi kleine Zimmer und können wählen, ob sie lieber im oberen Zimmer wohnen wollen (dort ist es wärmer), oder ob sie lieber ein bißchen weiter unten den Tag verbringen wollen (wenn es draußen sowieso schon heiß ist).
Außerdem sollte der Kasten mindestens zwei bis drei Meter hoch gehängt werden und einen freien Anflug haben. Wichtig ist zudem, dass die Kästen dicht sind und es nicht zieht, denn Fledermäuse reagieren sehr empfindlich auf Zugluft.
Die Zeit war mal wieder viel zu kurz – kaum waren die Kästen fertig, da kamen auch schon die Eltern zum Abholen. Uns hat es wieder einmal sehr viel Spaß gemacht! Bis zum nächsten Mal!